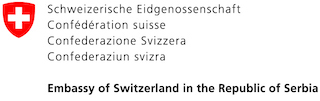Von Maja (übersetzt von Annika Will)
Dieser Text ist auch auf Ukrainisch, Französisch und Serbisch verfügbar.
Der Krieg in der Ukraine hat Millionen Menschen ins Exil getrieben. Ukrainer:innen, aber auch Menschen aus Russland und Belarus, die vor dem Moskauer Regime fliehen und in Serbien Zuflucht gefunden haben. Wie blicken sie auf ihre aktuelle Situation ? Wie erleben sie das Exil und ihre vielleicht endgültige Ausreise ? Hier kommen sie zu Wort.
Das menschliche Gehirn ist eine erstaunliche Sache, und sicher noch nicht vollständig erforscht.
Der Krieg in der Ukraine begann 2014. Mir scheint es, als wäre das gestern gewesen. Aber gleichzeitig habe ich in den letzten Jahren so gelebt, als ob im Land nichts besonderes los wäre. Kriegsmüde war ich nicht. Ich wollte einfach mein Leben leben. Auch jetzt will ich das noch, aber ich kann nicht.
Wie jeder Mensch hatten wir große, manchmal fast grandiose Pläne. Während im ganzen Land alle mit einer Invasion rechneten, bereiteten meine Mutter und ich ganz andere Veränderungen in unserem Leben vor. Wir wollten umziehen, und als der Makler sagte, dass es in der aktuellen Situation schwierig werden würde, die Wohnung zu verkaufen, haben wir ihm fast nicht geglaubt – unser Plan stand schließlich fest.
Am 23. Februar rief mich spätabends meine Tante aus Simferopol an. Sie war vor einigen Jahren nach Kiew umgezogen, um näher bei ihren Kindern zu sein, die schon seit der Annexion der Krim dort lebten. Wir sprechen sehr selten miteinander, eigentlich fast nie. Plötzlich fing sie an zu weinen und sagte, die Russen würden uns angreifen, und fragte sich, wie sie jetzt weiterleben sollte – wo sie doch mit der russischen Kultur aufgewachsen ist, mit Puschkin, Tschaikowsky und so weiter. Es war ein sehr merkwürdiges Gespräch, aber meine Mutter und ich erklärten es uns mit dem schon recht hohen Alter meiner Tante.
Am 24. Februar frühmorgens rief die Cousine meiner Mutter an, die auch in Kiew wohnte, und schrie irgendwelches Zeug über die Dringlichkeit, auf Vorrat zu tanken, in den Hörer – es gebe nämlich nirgendwo mehr Benzin, und ähnliche Dinge. Wir verstanden überhaupt nichts und ich sagte, in Kiew müsse wohl mal wieder was zusammengebrochen sein. Mama scherzte, ein Krieg habe begonnen, und wir hätten wie immer alles verschlafen. Wir waren schon zu wach, um wieder schlafen zu gehen, also gingen wir Tee und Kaffee trinken und scrollten durch die sozialen Netzwerke.
Ich fing als erste von uns an, die Nachrichten zu lesen. Und da verstand ich den ganzen Horror : dass es nicht mehr derselbe Krieg wie vorher, sondern eine großangelegte Invasion war. Ich weiß nicht mehr, was meine ersten Gedanken waren.
An diesem Tag wollten wir ehrenamtlich in einem Hunde-Tierheim arbeiten. Wir waren spät dran, denn wir hatten erst mal eine Weile gebraucht, um uns wieder zu sammeln, und wussten nicht recht, was wir tun sollten. Ich erinnere mich, wie glücklich ich über den halbvollen Tank des Autos war – das würde reichen, um eine Zeitlang zum Tierheim zu fahren und wieder zurück. Ich war auch erleichtert, dass das Hundefutter vor kurzem geliefert worden war und wir genug Futter für unsere Hunde zu Hause hatten. Dieser Tag war wahrscheinlich der kürzeste in meinem ganzen Leben.
Als ich vom Tierheim zurückkam, habe ich mit dem jüngeren unserer Hunde einen langen Spaziergang im Park gemacht. Ich sah dort eine ganze Menge verwirrter Menschen mitten an einem Werktag mit ihren Hunden spazieren. Die Stadt stand plötzlich still : Kein Benzin, Kartenzahlung unmöglich, kein Bargeld in den Bankautomaten. Ich hatte verschiedene Gedanken im Kopf, sie waren düster, aber der Gedanke, die Stadt zu verlassen, war nicht dabei. Am Abend war ich in den sozialen Netzwerken unterwegs, auf der Suche nach wenigstens ein paar Informationen.
So war die erste beunruhigende Nachricht, die ich sah, ein Post über die Ermordung eines Hundetrainers und seiner Hunde in der Region Charkiw durch die russischen Besatzer. Er wollte die Tiere retten, sie aus der umzingelten Stadt evakuieren. Dieses schreckliche Video habe ich immer noch vor Augen. In den sozialen Netzwerken schrieb eine Kollegin aus Belarus, aus ihrer Sicht gebe es keinen Grund, dass Ukrainer und Russen sich streiten, sie sollten lieber Frieden schließen. Als Antwort habe ich ihr eine Direktnachricht mit dem Video geschickt und gefragt, wie man sich versöhnen soll, wenn ich und meine Hunde ebenso gut anstelle dieses Mannes hätten stehen können. Sie antwortete so was wie „Was soll man machen, was da passiert, ist Politik…“. Mir fehlten die Worte und ich habe innerlich alle Russen und Belarussen aus der Kategorie der menschlichen Wesen abgeschrieben. Leider scheinen sie auch heute noch immer nichts verstanden zu haben.
Schließlich schien es, als sei alles in Ordnung : die Stadt war nicht erobert worden, wurde nicht bombardiert, Strom und Heizung funktionierten. Was wollte man mehr ?
Die erste Kriegswoche verbrachten wir völlig isoliert zu Hause oder auf der Suche nach Essens- und Medikamentenvorräten für mögliche Notfälle in der Zukunft. Eine Woche später begannen Freunde aus dem Ausland, mir zu schreiben, und fragten, wie es mir geht. Es war seltsam, denn ich wusste erst gar nicht, was ich antworten sollte. Schließlich schien es, als sei alles in Ordnung : die Stadt war nicht erobert worden, wurde nicht bombardiert, Strom und Heizung funktionierten. Was wollte man mehr ?
Das schrieb ich ihnen, aber auch, dass die Situation in Charkiw für befreundete Hundetrainer furchtbar sei. Viele von ihnen hatten kein Dach mehr über dem Kopf, kein Geld, und besonders schlimm war für mich, dass es in der Stadt kein Hundefutter mehr gab. Dagegen musste etwas getan werden. Ausländische Freunde haben mir Geld geschickt, davon habe ich in Kiew fast eine Tonne Futter gekauft. Blieb die Frage, wie es nach Charkiw kommen sollte. Außerdem mussten wir eine Lösung für die Evakuierung einer Freundin meiner Mutter finden.
In diesem Strudel aus Fragen und Entscheidungen war das Leben irgendwie leichter : es blieb gar keine Zeit zum Nachdenken. Obwohl sich immer wieder dumme Gedanken in meinen Kopf schlichen. Zum Beispiel quälten mich Gedanken über meinen jungen Hund, der damals erst fünf Monate alt war. Was für eine Idiotin war ich gewesen, ihn ein paar Monate zuvor aus einem EU-Land in die Ukraine zu holen ! Was sollte ich tun ? Ihn so schnell wie möglich wegbringen, dem Züchter zurückgeben oder eine neue Familie für ihn suchen ?
Damals genauso wie heute haben die Hunde mir immer geholfen, bei Verstand zu bleiben, oder es zumindest zu versuchen. Ist man bei Sinnen, wenn man acht Hunde hat ? In der Ukraine hatte ich fünf, aber das ist eine andere Geschichte.
Meine Mutter ist aus ihrem Zimmer zu mir gerannt, ich rief, sie solle sich sofort auf den Boden legen, dann hat es zum zweiten Mal geknallt.
Lange war ich niedergeschlagen wegen der Situation in der Stadt. Nichts schien sich zu bewegen, und deshalb kam mein Hirn auf alle möglichen Verschwörungstheorien. Wenig später begannen Luftangriffe in der Region. Die ersten Luftalarme machten meiner Mutter große Angst, besonders dann, wenn ich draußen mit den Hunden unterwegs war, wenn die Sirene zu heulen begann. In unserer Nähe gab es keinen Luftschutzraum. Nach ein oder zwei Tagen haben wir uns an die Sirenen gewöhnt. Einmal sind wir sogar währenddessen in Ruhe spazieren gegangen. Bis der erste echte Luftschlag Kiew getroffen hat.
Den werde ich nie vergessen : Es war ein Samstagmorgen. Die erste Explosion war ganz in unserer Nähe. Ich bin vom Bett auf den Boden gerollt und habe dabei fast meinen Hundewelpen erdrückt. Ich weiß immer noch nicht, wie ich so schnell reagieren konnte. Meine Mutter ist aus ihrem Zimmer zu mir gerannt, ich rief, sie solle sich sofort auf den Boden legen, dann hat es zum zweiten Mal geknallt.
Nach einer Weile sind wir aufgestanden und haben aus dem Fenster geschaut, um zu sehen, ob etwas beschädigt war oder ob man irgendwo Rauch sehen konnte. Dann hat die Luftabwehr zurückgeschlagen. Ich hatte keine Angst, zu sterben, aber ich hatte Angst um die Leben anderer, um meine Mutter und meine Hunde.
Damals näherte sich die Frontlinie den Grenzen unserer Region. Alle hatten schreckliche Angst vor einer Besatzung. Butscha und andere Dörfer ringsum waren noch nicht befreit und die Welt hatte den Schrecken der russischen Besatzung noch nicht gesehen. Ich dagegen hatte ihn mit eigenen Augen gesehen, als ich 2014 freiwillige Helfer:innen in den Osten unseres Landes fuhr.
Die Angst war stärker als ich. Ich beschloss, dass ich die Stadt verlassen musste. Meine Mutter wollte unter keinen Umständen weggehen. Um sie zu überzeugen, musste ich ihr Angst einjagen, indem ich ihr Fotos und Videos aus den besetzten Dörfern und Städten zeigte. Es war eine sehr schwierige Entscheidung. Ich sagte mir „es ist nur eine Reise“, als ob wir beschlossen hätten, den Frühling und den Sommer auf dem Balkan zu verbringen.
Doch in Wirklichkeit ist seitdem mein Leben auf Pause. Seit dem 24. Februar fühle ich mich wie eine Tote. Ich esse, ich atme, ich mache dieses oder jenes, ich nehme in Serbien sogar meinen Hund mit zu Ausstellungen. Aber all das ist nicht, wie es sein sollte. Ich tue die Dinge nicht, weil ich es will, sondern weil sie getan werden müssen. Aber mein Leben ist das nicht. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich es eines Tages wiederfinden werde.
Dieser Artikel wurde mit freundlicher Unterstützung der Schweizer Botschaft in Belgrad und der Heinrich-Böll-Stiftung in Serbien veröffentlicht.